An Atlas of Commoning: Places of Collective Production

Esso-Houses Hamburg, Requiem of the Megafonchor © Margit Czenki
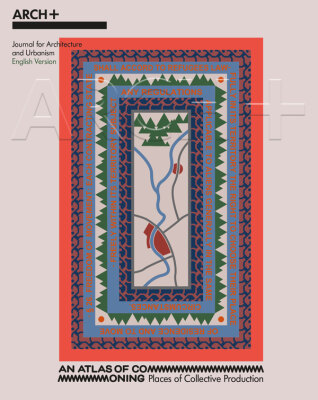
Intro
2–3
Editorial
4–5
Project
8
Project
9
Project
10–11
Project
12–13
Essay
14–19
Essay
20–25
Interview
26–31
Essay
32–43
Essay
44–47
OWNERSHIP AND ACCESS
Chapter
Diagram
50–53
Interview
54–61
Project
62–69
Project
70–75
Project
76–79
Project
80–81
Project
82–83
Project
84–87
Interview
88–91
Project
92–96
Project
97–101
Project
102–105
Essay
106–107
Project
108–109
PRODUCTION AND REPRODUCTION
Chapter
Diagram
112–115
Case Study
116–120
Project
121
Essay
122–127
Essay
128–139
Project
140–145
Project
152–155
Essay
156–161
Project
162–163
Project
164–167
Project
168–169
Project
170–173
Essay
174–179
Project
180–181
Essay
182–183
RIGHT AND SOLIDARITY
Chapter
Diagram
186–189
Project
190–193
Essay
194–201
Project
202–205
Essay
206–209
Project
210–213
Project
214–215
Essay
216–217
Project
218–221
Project
222–225
Essay
226–229
Project
230–231
Project
232–233
Diagram
234–235
Features
237–254